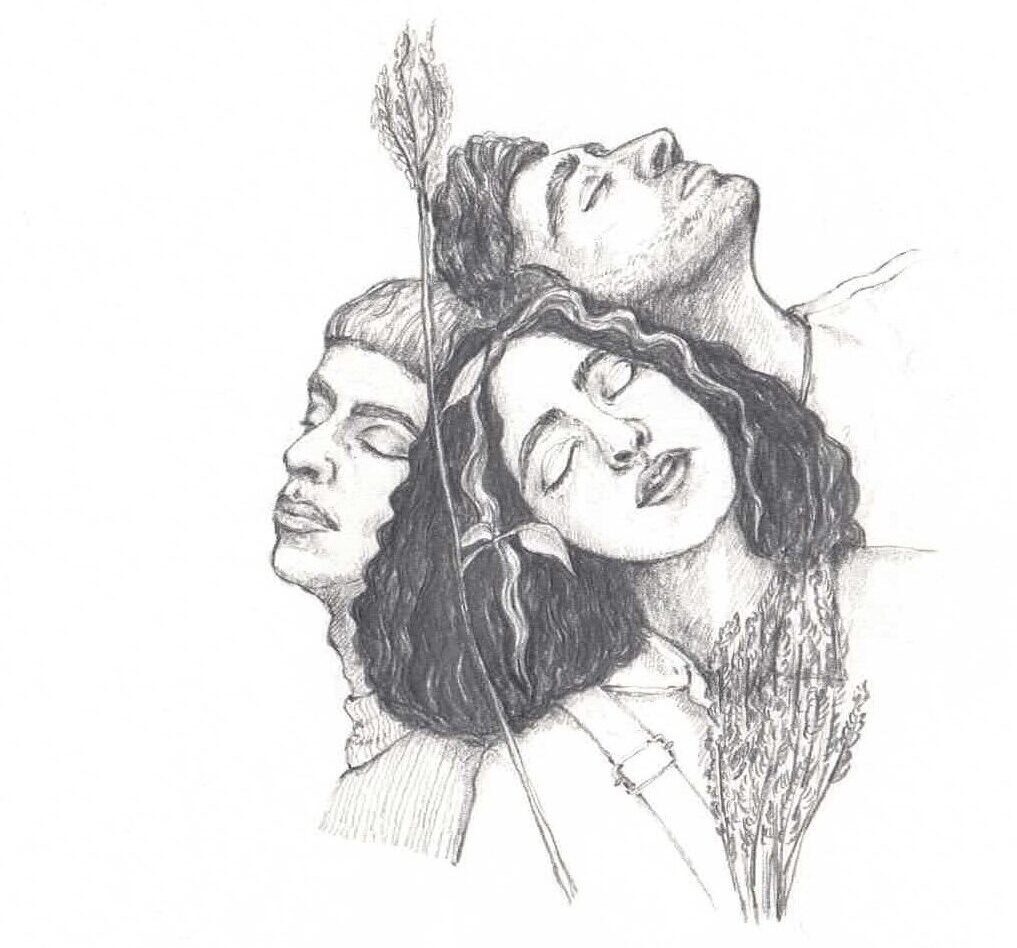
Seit dem Aufkommen des Black-Lives-Matter-Movements sind Themen wie Rassismus, strukturelle Ungleichheit und weiße Hegemonie in aller Munde. Systematische Diskriminierungsformen und ihr Zusammenwirken, genannt Intersektionalität, bestimmen die Machtstrukturen unserer Gesellschaft. Menschen, die jener (intersektionalen) Diskriminierung ausgesetzt sind, muss Platz und Präsenz in gesellschaftlicher Mitte eingeräumt werden. Das bietet der autobiographische Coming-of-Age-Film Futur drei (2020) von Faraz Shariat, wie kein anderer Film zuvor. Er gibt einen Ausblick auf eine Zukunft der multiperspektivischen Repräsentation: Postmigrantisches Kino, welches die genannten Problematiken als Teil des Alltags migrantisierter Menschen zeigt, es jedoch gleichzeitig schafft, Identitäten mehrdimensional darzustellen. Und das vielleicht zum ersten Mal im deutschen Kino?
Das Konzept einer postmigrantischen Gesellschaft beschreibt eine Gesellschaft, die Migration als einen natürlichen Teil ihrer selbst anerkennt und auf institutioneller, gesellschaftsstruktureller und politischer Ebene einen Wandel stattfinden lässt. Dieser denkt die Realitäten migrierter Menschen und ihrer nachfolgenden Generationen mit. Im Kern geht es also um die Anerkennung von Migration als wesentlichen Faktor, der unsere Gesellschaft mitgestaltet und formt. „Postmigrantische Gesellschaft“ meint auch, dass das Konzept des „Deutsch-Seins“ nicht mehr an ein rassifiziertes Aussehen oder an einen rassifizierten Namen gebunden ist, sondern die Gesellschaft sich künftig völlig von solchen Stereotypen löst.
Parvis, eine der Hauptfiguren in Futur drei, wächst gut behütet im überwiegend weißen, provinziellen Hildesheim auf. Seine Eltern sind vor längerer Zeit aus Iran nach Deutschland migriert. Parvis positioniert sich als queer, geht in seiner Freizeit gerne feiern und nutzt die Datingapp „Grindr“ in vollen Zügen. Aufgrund eines Diebstahls muss er Sozialstunden in einem Wohnprojekt für geflüchtete Menschen ableisten und kommt so mit jungen Menschen in Berührung, die im „heutigen“ Iran geboren und aufgewachsen sind. Er freundet sich mit den Geschwistern Banafshe und Amon an, die auf ihr Asylverfahren warten. Die drei Teenager bauen eine innige und liebevolle Beziehung zueinander auf. Sie müssen aber immer wieder schmerzlich feststellen, wie ihre Lebensrealitäten an vielen Stellen auseinanderdriften, obwohl sie sich emotional nicht näher sein könnten.
In der Handlung des Filmes werden wie selbstverständlich (rassistische) Diskriminierungserfahrungen in alltäglichen Zusammenhängen gezeigt beziehungsweise angesprochen, ohne sie als „anormal“ oder besonders erwähnenswert darzustellen. Dabei wird der jeweilige Charakter, der diese Erfahrungen macht, jedoch nicht als eindimensionale Figur dargestellt, die bloß als Platzhalter für ein Opfer rassistischer Gewalt dient. Die Charaktere werden hier intersektional und ohne identitätspolitisches Kalkül gezeichnet. Diese ganzheitliche und facettenreiche Darstellung kennt mensch meist von weißen Filmfiguren.
Ein Beispiel für eine „abgeschwächte“, aber dennoch als schmerzhaft empfundene Form des Rassismus, die im Film gezeigt wird, ist das Othering (auch „Veranderung“). Der Prozess des Otherings wird beispielsweise in einer Filmszene deutlich, in der das weiße Tinder-Date von Parvis, ihm plump die Herkunftsfrage stellt. Zugleich wird er offensiv mit rassistischen Stereotypen konfrontiert, wie zum Beispiel einer, aus eurozentrischer Perspektive, vermeintlich „starken“ Körperbehaarung. Ihm wird also das Gefühl gegeben, „der Andere“, „der Fremde“ zu sein.
Auch Gedanken und Gefühle, die der First Generation (hier: die Kinder migrierter Menschen) vielleicht bekannt vorkommen könnten, finden ihren, sonst im Mainstream-Kino nicht gegebenen Platz in der Handlung. Ein Beispiel für eine zentrale Kernproblematik, wird in einem Gespräch zwischen Parvis und seiner großen Schwester Mina, deutlich. Parvis beschreibt das Gefühl, die Erinnerung an den Schmerz seiner Eltern zu sein. Hierbei könnte es um die Angst gehen, sich durch die Sozialisierung in Deutschland, emotional und kulturell von seinen Eltern automatisch distanzieren zu müssen. Dabei spielt der Druck der weißen Dominanzgesellschaft, auch „Integration“ genannt, eine immens wichtige Rolle. Es ließe sich auch als einen zum Scheitern verurteilten Balanceakt beschreiben: Die Erfüllung der Erwartungen der weißen Dominanzgesellschaft, die individuelle Selbstfindung und Identitätsbildung, die Angst vor „kultureller Entfremdung“ und die dadurch entstehende Befürchtung, seinen Eltern Schmerz zuzufügen. Aber nicht die Migration ist die Ursache für diese emotional hoch beanspruchenden Herausforderungen. Vielmehr findet diese Problematik ihren Ursprung in der ständigen Beobachtung, Kategorisierung, (Vor-)Verurteilung und ignoranten, absurden Erwartungshaltung der weißen Dominanzgesellschaft marginalisierten Menschen gegenüber. Ohne, dass jene Dominanzgesellschaft sich dabei der eigenen weißen Machtposition und der Lebensrealitäten von BIPoC (Black, Indigenous, People of Color) bewusst zu sein scheint.
Der Film Futur drei ist unfassbar wichtig und zukunftsweisend für den deutschen Film, da er für das Mainstream-Kino anscheinend „nischige“ Lebenswirklichkeiten mitdenkt. Und das ohne ihre als von der Dominanzgesellschaft scheinbar wahrgenommene „Andersartigkeit“ in den Mittelpunkt der Handlung zu stellen. Es ist im Grunde ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass diverse Lebenskonstellationen in Mainstream-Medien selten ganzheitlich dargestellt werden. Es geht meist nur um ein bestimmtes, für „anders“ deklariertes „Alleinstellungsmerkmal“ einer marginalisierten Person. Im Film werden darüber hinaus Lebensrealitäten von BIPoC nicht idealisiert und die damit verbundenen Diskriminierungserfahrungen nicht komödisiert, sondern in ihrer subtilen, aber umso härteren Tatsächlichkeit aufgezeigt. Futur drei schafft es somit, die Ära des deutschen postmigrantischen Kinos einzuläuten. Eine Ära, die in Deutschland endlich ihren bitternötigen Anfang setzen konnte, getragen von den migrantisierten und marginalisierten Stimmen unserer Gesellschaft, die sich den Weg in ihre Mitte erkämpfen müssen.
weiß wird hier klein und kursiv geschrieben, da es sich um eine sozio-politisch privilegierte Machtposition handelt, die auf historischer bzw. kolonialer Kontinuität beruht.
Rassifizierung meint in diesem Text die Zuschreibung vermeintlicher „ethnischer Herkunft“ auf Grundlage des Aussehens oder Namens.
migrantisierte Menschen sind Personen, die aufgrund von bestimmten (äußerlichen) Merkmalen als „nicht-deutsch“ wahrgenommen und denen gleichzeitig Migrationserfahrungen zugeschrieben werden.
Eurozentrismus meint die Beurteilung und Kategorisierung von Menschen, Kulturen und Traditionen mit dem Maßstab europäisch oder weiß beanspruchter Werte und Normen.
Futur Drei
Regie: Faraz Shariat
Darsteller*innen: Banafshe Hourmazdi, Eidin Jalali, Benjamin Radjaipour
Genre: Drama, Romantik
Erscheinungsdatum: 24. September 2020 (D)
Dauer: 92 Minuten
Streaming-Dienste: kostenpflichtig auf Amazon Prime Video, iTunes, Google Play
Auch auf DVD und Blu-ray erhältlich
Von Daria Zomorodkia
Beitrag erstellt am: 24.05.2021 um 09:29 Uhr
Letzte Änderung am: 24.05.2021 um 09:29 Uhr